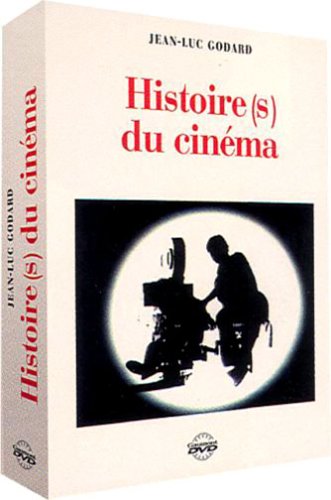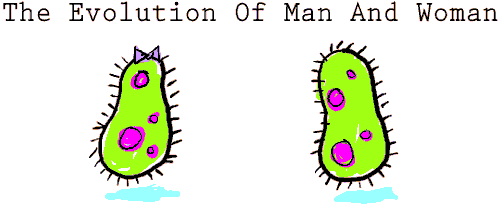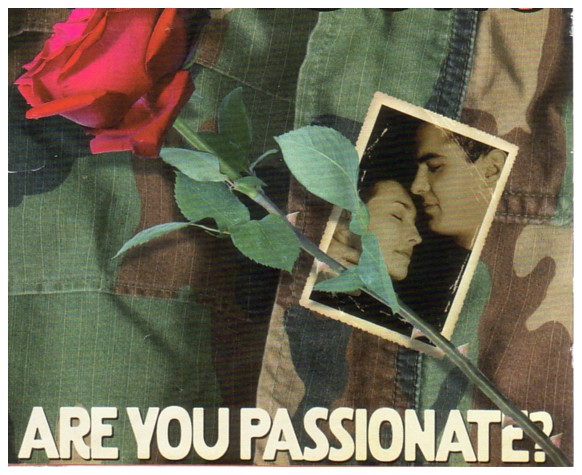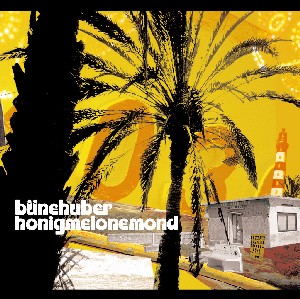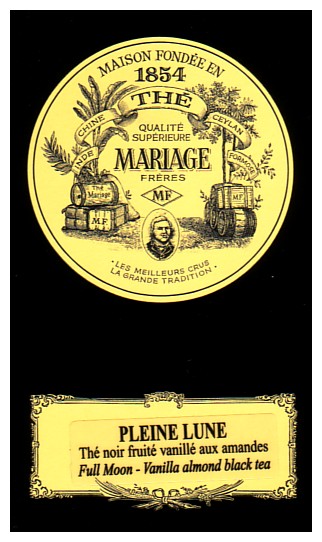Sonntag, November 20, 2005, 21:28 - PRESSE
"Don't ask me nothin' about nothin' - I just might tell you the truth." (Bob Dylan)Bislang gehörte es zum Setting, dass er schwieg, wenngleich auf die beredteste Art und Weise. Virtuos seine Taktiken, keine Interviews zu geben. Legendär seine ans Nullsilbige grenzende Lakonie auf Konzerten. Ließ er sich doch einmal zu einem Kommentar hinreißen wie damals in der Free Trade Hall zu Manchester, als die Judas-Rufe im Publikum so laut wurden, dass kurzfristiges Zurückbelfern nicht zu vermeiden war, überließ er die abschließende Antwort immer noch der Band, die bereits hinter ihm mit den elektrischen Gitarren im Anschlag wartete. Auslöschung von Rede durch Sound, die überlieferte Anweisung: »Play it fucking loud!«
Sollte dereinst einmal Bob Dylans gesammeltes Schweigen erscheinen, es füllte Bände. Eine Bibliothek nicht gesprochener Worte, übertroffen nur von den gesammelten Fußnoten seiner Jünger, herausgefordert vom Schweigen des Meisters. Vielleicht wird Dylan, der nichts mehr hasst als die Schubladen, in die man ihn stecken wollte, nach seinem Tod einmal nicht als Sänger, sondern als Psychoanalytiker seiner Generation in die Geschichte eingehen. Schließlich hat er Fantasien aller Art auf sich gezogen, um sie zugleich an den Absender zurückzuweisen, und so einen unendlichen Strom der Rede provoziert. Sicher ist, dass dieses Gleichgewicht des Schreckens vier Jahrzehnte andauerte. Umso überraschender, dass er sich nun zu einem sensationellen Schritt entschlossen hat: Er spricht.
Kein Witz. In Martin Scorseses dreieinhalbstündiger Dokumentation No Direction Home spricht Dylan über Dylan. Und zwar nicht, wie in den vergangenes Jahr erschienenen Chronicles, in dürren Buchstaben, nein, er hält seinen alt gewordenen Dickschädel frontal in die Kamera, sodass man darin lesen kann wie in einem Buch. Eine Autobiografie der Linien und Falten unter beachtlichen Tränensäcken, gekrönt von der berühmten Pudelfrisur, die mehr denn je wirkt wie eine falsch herum aufgesetzte Perücke. Als wäre das nicht schon schockierend genug, scheint er auch noch zu lächeln. Deutlich genug jedenfalls, um einen ebenso eindeutigen wie unerhörten Befund zu rechtfertigen: Dylan kann selbstironisch sein. In all den Jahren hat der alte D. eine gewisse Distanz zu der Figur entwickelt, die er in den frühen Sechzigern einmal war. (...)
Dies und noch mehr ist nachzulesen im lesenswert-schönen Artikel von
Thomas Gross in der ZEIT 43/20.10.2005: